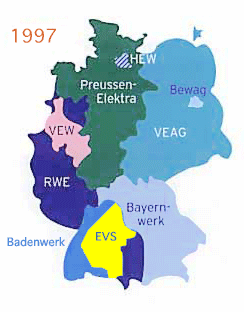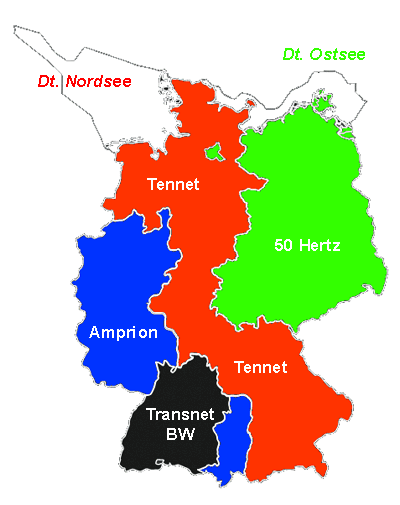|
|
|
|
Bis 1997 gab es in Deutschland neun Übertragungsnetzbetreiber
und neun Regelzonen. In den folgenden fünf Jahren verringerte
sich diese Zahl auf vier. Bis 2010 bekamen drei davon neue
Namen. |
|
Heute haben die Gebiete der vier verbliebenen
Übertragungsnetzbetreiber denselben Zuschnitt wie schon vor über
zwanzig Jahren. Sie haben aber zum Teil erneut den Namen
gewechselt: Aus Transpower wurde TenneT und aus der EnBW
Transportnetze AG die TransnetBW. Neu hinzugekommen sind die
Offshore-Gebiete vor der Küste. |
TransnetBW gehört weiterhin der öffentlichen
Hand
Und das ist auch gut so, weil kritische Infrastruktur
nicht privaten Profitinteressen ausgeliefert werden darf
(zu 231108)
Vor über zehn Jahren entschied sich die Energie Baden-Württemberg
(EnBW) als einziger der vier großen deutschen Energiekonzerne nicht für
das Modell der eigentumsrechtlichen Entflechtung, sondern für die Option
des "Unabhängigen Transportnetzbetreibers", die auf nachdrückliches
Verlangen Frankreichs von der EU-Kommission zugestanden werden musste (090401).
Bei dieser Option wurde den Stromkonzernen ihre herkömmliche integrierte
Struktur aus Netz, Erzeugung und Versorgung grundsätzlich belassen. Zu
den eher geringfügigen Abstrichen gehörte, dass der Name der Netztochter
nicht mehr auf den Mutterkonzern verweisen durfte. Die ab März 2012 erfolgte
Umbenennung der EnBW Transportnetze AG in TransnetBW GmbH signalisierte deshalb
keinen bevorstehenden Verkauf wie bei E.ON, RWE und Vattenfall, als diese ihre
Transportnetzbetreiber in "Transpower", "Amprion" und "50Hertz"
umbenannten, sondern den Antrag auf Zertifizierung als "Unabhängiger
Transportnetzbetreiber" (UTB) durch die Bundesnetzagentur.
Vor kurzem sah es so aus, als wolle die EnBW den damit erlangten
Sonderstatus ihres Übertragungsnetzbetreibers in der deutschen Stromlandschaft
leichtfertig aufs Spiel setzen, indem sie nach privaten Investoren Ausschau
hielt, die ihr für knapp die Hälfte aller Anteile möglichst viel
Geld bieten würden (220212). Es zeigte sich indessen
bald, dass nicht so heiß gegessen werden sollte wie gekocht wurde.
Zwar war dann durchaus von Blackrock, Allianz, Copenhagen Infrastructure Partners
und vielleicht noch anderen derartigen Investoren die Rede, aber es schien dabei
doch eher um Benchmarking zu gehen, um Anhaltspunkte für einen diskutablen
Preis zum Verkauf an zwei Anleger der öffentlichen Hand zu gewinnen: Der
eine dieser Anleger war die Bundesregierung in Gestalt der KfW-Bank, der andere
die Sparkassen aus dem Umkreis der kommunalen EnBW-Aktionäre (220212,
230513).
Inzwischen ist der Verkauf an beide vereinbart und es steht somit
fest, dass TransnetBW weiterhin in öffentlicher Hand bleibt, obwohl die EnBW
– die ihrerseits fast hundertprozentig dem Land und baden-württembergischen
Kommunen gehört – nur noch knapp über die Mehrheit verfügt (231108).
Und das ist auch gut so, weil in dieser Hinsicht schon viel falsch gemacht wurde.
Vor allem die Bundesregierung hat mindestens schon zwei Milliarden Euro Lehrgeld
für überaus schmerzlichen Anschaungsunterricht zahlen müssen, welcher Sorte
von Investoren man aus dem staatlich regulierten Bereich der Stromwirtschaft
tunlichst heraushalten sollte (siehe weiter unten).
Die Tücken des "natürlichen Monopols" Stromnetze wurden von
den neoliberalen Zauberlehrlingen gewaltig unterschätzt
Aber das ist gar nicht so einfach. Die von der EU-Kommission betriebene
eigentumsrechtliche Entflechtung der Übertragungsnetzbetreiber war eine
logische Konsequenz ihrer Bemühungen, die bisher staatlich geprägten
Strukturen der europäischen Stromwirtschaft so weit wie möglich zu
liberalisieren und zu deregulieren. Einfacher gesagt: Es ging darum, auch diesen
Bereich der Wirtschaft so weit wie nur möglich für private Profitinteressen
zu öffnen. Ein unüberwindbares Hindernis blieb dabei jedoch das "natürliche
Monopol" des Netzbetriebs, das auch die EU-Kommission nicht abschaffen
konnte und das sogar umso mehr der staatlichen Regulierung bedurfte, je stärker
die Bereiche Stromerzeugung und Stromvertrieb für den Wettbewerb geöffnet
wurden. Das volle Ausmaß dieser Dialektik wurde den neoliberalen Zauberlehrlingen,
die damals mit großer Hartnäckigkeit die Deregulierung des europäischen
Strommarktes betrieben, allerdings erst relativ spät klar.
Die von der EU-Kommission forcierte eigentumsrechtliche Entflechtung
des Netzbetriebs von den Bereichen Erzeugung und Vertrieb war insofern die vernünftige Konsequenz aus
einer eher unvernünftigen, weil stark ideologisch geprägten Deregulierung
der Stromwirtschaft. Ihr größter Widersacher war und blieb Frankreich,
das seine staatlich monopolisierte Stromwirtschaft offensiv als "service
public" verteidigte (010613, 030707).
Auch die vier deutschen Stromkonzerne lehnten die eigentumsrechtliche Entflechtung
lange Zeit entschieden ab und konnten sich dabei der Unterstützung durch
die Bundesregierung sicher sein.
Am Ende der Auseinandersetzung gab es gleich drei Entflechtungs-Optionen
Ein erstes Zugeständnis war das Konzept des "Independent
System Operator" (ISO), das die Kommission gegen den Widerstand des EU-Parlaments
als Kompromiss vorschlug (080603) und wenig später
durch das noch weitergehende Modell des "Indipendent Transmission Operator"
(ITO) ergänzte (090303). In den beiden neuen EU-Richtlinien
für die Binnenmärkte bei Strom und Gas, die 2009 in Kraft traten,
gab es deshalb am Ende insgesamt drei Entflechtungs-Optionen (090401).
Als Alternative zur eigentumsrechtlichen Entflechtung war dabei aber nur noch
der "Independent Transmission Operator" (ITO) von Bedeutung. Auf deutsch
war das der "Unabhängige Transportnetzbetreiber" (UTB), für
den sich nach der Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht die EnBW entschied,
indem sie bei der Bundesnetzagentur einen entsprechenden Antrag stellte.
Man hätte nun eigentlich erwarten dürfen, dass sich
auch die drei anderen Energiekonzerne für das UTB-Modell entscheiden würden,
nachdem sie so lange gegen die eigentumsrechtliche Entflechtung Sturm gelaufen
waren. Seltsamerweise war das aber nicht der Fall. Den ersten Kurswechsel vollzog
der E.ON-Konzern, als er im Februar 2008 der EU-Kommission die Bereitschaft
zum Verkauf seines Übertragungsnetzes signalisierte (080201).
Den damaligen Bundeswirtschafsminister Michael Glos (CSU) hat das so erbost,
dass er vor dem Plenum des Bundestags von einem "faulen Deal" zwischen
E.ON und Brüssel sprach (080305). In der Tat hatte
sich der E.ON-Konzern einige krumme Dinger geleistet und damit der EU-Kommission
die Gelegenheit geboten, ihn unter Druck zu setzen (070710,
080106). Die Daumenschrauben wurden aber nur gezeigt.
Zum befürchteten Anlegen kam es nicht, weil E.ON seinen Übertragungsnetzbetreiber
"Transpower" für 1,1 Milliarden Euro dem niederländischen
Netzbetreiber TenneT verkaufte (091101).
Konzerne verscherbelten ihre Netze, weil Kraftwerke, Stromhandel
und Vertrieb weit mehr Profit verhießen
Es war aber nicht nur die begründete Angst vor Sanktionen,
die E.ON zu diesem Umschwenken veranlasste. Vielmehr scheint sich damals in
den Vorstandsetagen der Energiekonzerne allgemein die Einschätzung verbreitet
zu haben, dass das Netzgeschäft stark an Attraktivität eingebüßt
habe und noch weiter verlieren werde, nachdem es trotz aller Anstrengungen der
Lobby nicht gelungen war, die Errichtung einer Regulierungsbehörde für
den Strom- und Gasmarkt zu verhindern (030301). Die
neugeschaffene Bundesnetzagentur, die 2005 im Energiewirtschaftsgesetz verankert
wurde (050701), zeigte nämlich zunehmend Biss,
indem sie Netzbetreibern eigenmächtige Netzentgelt-Erhöhungen untersagte
(060509) oder zu den für ihre Arbeit erforderlichen
Auskünften verpflichtete (070613). Dem Vattenfall-Konzern
wurden die beantragten Netzentgelte sogar um 18 Prozent gekürzt (060601),
und der E.ON-Konzern bekam eine dicke Rüge für den europaweiten Stromausfall,
den er am 4. November 2006 verursachte (070205).
Kurzum: Für den auf "shareholder value" getrimmten
neoliberalen Zeitgeist war das Netzgeschäft ziemlich unattraktiv geworden. Dieselben
Konzerne, die jahrelang gegen die eigentumsrechtliche Entflechtung Sturm liefen,
überließen deshalb ihre Transportnetzbetreiber nun mehr oder weniger
freiwillig solchen Anlegern, die mit einer zwar verläßlichen, aber
vergleichsweise bescheidenen Rendite vorlieb nahmen. Den so erzielten Verkaufserlös
investierten sie dann in neue Kraftwerke, Stromhandel und Stromvertriebe,
die weit größeren Profit verhießen.
E.ON, Vattenfall und RWE verkauften ihre Übertragungsnetze
zum Schnäppchenpreis von 2,6 Milliarden Euro
Im März 2010 – ein halbes Jahre nach dem Verkauf
des E.ON-Transportnetzes an TenneT – trennte sich auch der Vattenfall-Konzern
für 810 Millionen Euro von seinem ostdeutschen Übertragungsnetz,
das in "50Hertz Transmission" umbenannt wurde. Neuer Mehrheitseigner
wurde der belgische Netzbetreiber Elia, während der australische
Finanzinvestor IFM die restlichen 40 Prozent übernahm. Im Juli 2011
folgte schließlich auch der RWE-Konzern, der seinen in "Amprion"
umbenannten Übertragungsnetzbetreiber für rund 700 Millionen
Euro größtenteils einem Finanzkonsortium überließ
und lediglich eine Sperrminorität von 25,1 Prozent behielt (110705).
Insgesamt erlösten die drei Konzerne so rund 2,6 Milliarden
Euro für den Verkauf ihrer Übertragungsnetzbetreiber. Aus heutiger
Sicht war das ein unglaublicher Schnäppchenpreis, für den sich sämtliche
Übertragungsnetzbetreiber mühelos hätten verstaatlichen lassen
(die EnBW gehörte ja bereits der öffentlichen Hand). Die Gesamtsumme
entsprach jedenfalls näherungsweise dem bis heute nicht genau bekannten
Betrag, den die Bundesregierung 2018 aufwenden musste, um lediglich eine Minderheitsbeteiligung von 40 Prozent
an 50Hertz vor einem vermeintlich drohenden Zugriff der Chinesen zu bewahren.
Bei 50Hertz erpressten Finanzjongleure
die Bundesregierung zweimal um einen Milliardenbetrag
Der australische Miteigentümer des ostdeutschen Übertragungsnetzbetreibers
war nämlich auf die famose Idee gekommen, die Hälfte seiner
Beteiligung dem chinesischen Staatskonzern SGCC zu überlassen. Dieser
kaufte sich tatsächlich weltweit bei Netzbetreibern ein und war angeblich
bereit, dem australischen Finanzfonds für den 20-Prozent-Anteil an
50Hertz einen horrenden Preis zu zahlen. Der staatliche belgische Netzbetreiber
Elia – der kleiner war als seine günstig erworbene deutsche
Netztochter 50Hertz – wollte und konnte da nicht mitbieten. Die knappe
Milliarde Euro, mit der er sein Vorkaufsrecht schließlich doch ausübte,
stammte deshalb ganz oder weitgehend von der Bundesregierung, die den
Einstieg der Chinesen unbedingt verhindern wollte (180305).
Aber dadurch kamen die australischen Finanzjongleure erst so richtig
auf den Geschmack. Schließlich war der Erlös für die zwanzig
Prozent sechsmal so hoch wie der Kaufpreis, den sie vor sechs Jahren für
die gesamte Beteiligung gezahlt hatten. Prompt schlossen sie mit den Chinesen
einen zweiten Vertrag über den Verkauf der restlichen zwanzig Prozent und
teilten dies pflichtgemäß ihrem Konsortialpartner Elia mit, damit
dieser erneut Gelegenheit bekam, sein Vorkaufsrecht auszuüben. Der Preis
für diese zweite Tranche scheint nun sogar über der Grenze von einer
Milliarde gelegen zu haben, wobei allerdings wiederum bezweifelt werden durfte,
dass die Chinesen einen derart überhöhten Preis tatsächlich gezahlt
hätten, denn auch in China kann und muss man rechnen (180603).
Die Masche war aber jedenfalls erfolgreich: "Aus sicherheitspolitischen
Erwägungen" und zum "Schutz kritischer Energieinfrastrukturen"
machte die Bundesregierung erneut eine schätzungsweise siebenstellige Summe
locker. Wie groß die Finanzströme im einzelnen waren, wo sie eventuell
versickerten oder an die Bundesregierung zurückflossen, ist für Außenstehende
bis heute nicht ersichtlich. Sicher ist nur, dass als Folge dieser Affäre
die Staatsbank KfW bis heute eine 20-prozentige Beteiligung an 50Hertz besitzt
und die belgische Elia ihren Anteil auf 80 Prozent aufstocken konnte (180709).
Die TenneT erklärte sich außerstande,
ihre Verpflichtungen erfüllen zu können
Ärger gab es auch mit der TenneT, die zwar in den Niederlanden
der größte Netzbetreiber ist und sich gern als "erster grenzüberschreitender
Übertragungsnetzbetreiber in Europa" bezeichnete, aber ihre Verpflichtungen
als größter deutscher Transportnetzbetreiber zeitweise nicht vollständig
erfüllen konnte oder wollte. Das lag daran, dass der Ausbau der Erneuerbaren
Energien und die daraus resultierenden Netzausbauverpflichtungen einen unvorhergesehenen
Kapitalbedarf zur Folge hatten. Zunächst erfüllte TenneT vor allem
die mit dem festländischen Netzgebiet verbundene Verpflichtung zum Anschluss
von Offshore-Windkraftanlagen in der deutschen Nordsee nur sehr schleppend (120205).
Im November 2011 verschickte das Unternehmen sogar drei Schreiben an die Bundesregierung,
wonach es unter den bisherigen Umständen seinen Verpflichtungen als Netzbetreiber
nicht weiter nachkommen könne (111104). Die Bundesnetzagentur
nahm dies zum Anlass, um ihm die nach § 4a des
Energiewirtschaftsgesetzes erforderliche Zertifizierung zu verweigern, da offenbar
die notwendigen finanziellen Mittel zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen
fehlen würden (121105).
Ganz ungehört verhallten die Hilferufe von TenneT jedoch
nicht. Sie waren mit ein Grund dafür, dass die schwarz-rote Koalition die
Offshore-Ausbauziele drastisch absenkte und verschiedene andere gesetzliche
Änderungen vornahm. Knapp vier Jahre später bekam TenneT dann die
Zertifizierung doch noch und erklärte im Gegenzug seine Brandbriefe an
die Bundesregierung für erledigt (150908). Ein
weiterer großer Investitionsbedarf ergab sich später für TenneT
aus den Netzprojekten "Südlink" (131002,150204,
210808) und "Südostlink" (170302),
zumal diese dann auch noch wegen der Widerstände gegen die Trassenführung
vorrangig verkabelt werden sollten (151002).
Inzwischen will TenneT die deutsche Tochter ganz der Bundesregierung
überlassen
Vor diesem Hintergrund kündigte die niederländische
TenneT TSO B.V. am 10. Februar dieses Jahres an, dass sie den Verkauf ihrer
deutschen Tochter TenneT TSO GmbH an die Bundesregierung erwäge. "Der
Eigenkapitalbedarf von TenneT für dieses Jahrzehnt steigt", hieß
es in der Pressemitteilung. Es sei deutlich geworden, dass die niederländische
Regierung es vorziehe, die niederländischen Aktivitäten von TenneT
zu finanzieren, die derzeit schätzungsweise 10 Milliarden Euro erfordern
würden. Sie suche deshalb eine "strukturelle Lösung", um
den Eigenkapitalbedarf für die deutschen Aktivitäten von TenneT zu
decken, der derzeit auf 15 Milliarden Euro geschätzt werde (230201).
Der TenneT schwante frühzeitig, dass noch größere
Belastungen auf sie zukommen würde als die Netzanbindung der Offshore-Windkraftanlagen,
mit der sie sich bereits finanziell überfordert fühlte. Parallel zur
Forderung nach einer verbindlichen Langfristplanung für Offshore-Projekte
verlangte sie deshalb im Februar 2011 die Gründung einer "Deutschen
Gleichstrom-Netzgesellschaft". Diese sollte zunächst die HGÜ-Verbindungen
zu jenen Offshore-Windparks herstellen, die wegen ihrer weiten Entfernung von
der Küste nicht in Drehstromtechnik ausgeführt werden können.
Später aber – und als Schwerpunkt ihrer Tätigkeit – sollte
sie auch ein völlig neues Transportnetz in HGÜ-Technik planen, finanzieren,
bauen und betreiben, das die bestehenden Drehstrom-Transportnetze in Deutschland
überlagern und entlasten würde (120205).
Deutschland ist das einzige Land in der EU, das keinen nationalen
Übertragungsnetzbetreiber hat
Ob das wirklich eine ideale Lösung gewesen wäre, mag
dahingestellt bleiben, wenn man die Kosten der Konverterstationen bedenkt, die
allein schon die derzeit geplanten Punkt-zu-Punkt-Verknüpfungen mit dem
Drehstromnetz erfordern. Aber das war sicher nicht der Hauptgrund, weshalb TenneT
mit diesem Vorschlag sowohl bei der Politik als auch bei den drei anderen Übertragungsnetzbetreibern
auf taube Ohren stieß: Bei Amprion, 50Hertz und TransnetBW befürchtete
man nicht ganz zu Unrecht, dass TenneT den Hauptnutzen des Projekts haben würde
und sie vor allem die Kosten tragen müssten. Vermutlich bangte den Konkurrenten
aber auch vor einem bundesweit tätigen Netzbetreiber, der sie selber –
vor allem mit etwas staatlicher Nachhilfe - irgendwann schlucken könnte.
Denn Deutschland ist das einzige Land in der EU, das keinen nationalen Übertragungsnetzbetreiber
hat, sondern sich aus historischen Gründen den Luxus von vier gebietsweise
zuständigen Unternehmen leistet (siehe Grafiken).
Schon 2004 plädierte die Monopolkommission für eine
Zusammenfassung der vier Regelzonen von E.ON (später TenneT), RWE (später
Amprion), Vattenfall (später 50Hertz) und EnBW (später TransnetBW),
um den bisher nicht funktionierenden Markt für Regelenergie in Schwung
zu bringen (040701). Das wäre mehr oder weniger
auf die Zusammenfassung zu einer bundesweiten Netzgesellschaft hinausgelaufen.
Die Bundesnetzagentur hatte auf Antrag von Stromhändlern bereits ein Missbrauchsverfahren
gegen alle vier eingeleitet, weil sie ihre Netzgebiete nach wie vor separat
regelten und dadurch höhere Kosten entstanden als bei einer bundesweit
einheitlichen Regelung (080408). Um weitere Vorstöße
in dieser Richtung zu verhindern, mussten sich die vier Übertragungsnetzbetreiber
deshalb notgedrungen zu einer engeren Zusammenarbeit bereitfinden, die das Problem
des "Gegeneinander-Regelns" behob (081005).
Die Bundesnetzagentur stellte das eingeleitete Missbrauchsverfahren ein, nachdem
sich die vier verpflichtet hatten, bis Ende Mai 2010 einen "Netzregelverbund"
zu betreiben, der den Aufwand an Regelenergie stark verringerte (100301).
Die Entscheidung der EnBW für die von Frankreich erkämpfte
Entflechtungs-Option hatte auch mit ihrem Großaktionär EDF zu tun
Zum Schluss sei noch erwähnt, dass die Energie
Baden-Württemberg
nicht ganz zufällig der einzige der vier deutschen Stromkonzerne war,
der
unbeirrt die Option des "Unabhängigen Transportnetzbetreibers"
weiter verfolgte, während die drei andern ihre Übertragungsnetze
verscherbelten: Diese Sonderrolle hatte sicher auch damit zu tun, dass
die EnBW ein volles Jahrzehnt lang von der Electricité de France (EDF)
dirigiert wurde, die paritätisch mit dem Kommunalverband
Oberschwäbische
Elektriztätswerke (OEW) die Aktienmehrheit von 69 Prozent besaß (020714)
und sich zusätzlich die unternehmerische Führung gesichert hatte,
indem sie den kommunalen Aktionären als Gegenleistung 100 Millionen Mark
zahlte (010201). In den Geschäftsberichten der
EDF tauchte die EnBW fortan als "filiale" auf. Sie wurde quasi als
deutsche Tochter der EDF betrachtet. Damit verstand es sich von selbst, dass
sie mit ihrem Großaktionär auch im Streit um die Entflechtung konform
ging und nach der erfolgreichen Durchsetzung des "Unabhängigen Transportnetzbetreibers"
(UTB) sowohl der TransnetBW als auch dem Gasnetzbetreiber Terranets BW dieses
von Frankreich erkämpfte Entflechtungsmodell verpasste. "Wir sind
überzeugt, dass das Teil unseres Geschäfts ist", versicherte
unbeirrt der EnBW-Chef Hans-Peter Villis im März 2008, nachdem sich E.ON
auf den "faulen Deal" mit der EU-Kommission eingelassen hatte (080305).
Fast wäre die Zertifizierung als UTB doch noch durchkreuzt
worden
Allerdings gab es zuletzt doch noch eine kritische Situation,
bevor die Zertifizierung als UTB in trockenen Tüchern war: Die Stuttgarter
CDU-Landesregierung ließ sich nämlich 2010 mit Blick auf die bevorstehenden
Landtagswahlen im Frühjahr 2011 einen scheinbar besonders attraktiven Wahlschlager
einfallen, indem sie das EDF-Aktienpaket an der EnBW, das bis 1999 größtenteils
dem Land gehört hatte, für 4,7 Milliarden Mark zurückkaufte (000101).
Das teure Wahlkampfgeschoss erwies sich freilich schnell als Rohrkrepierer (110107,
110208, 111002). Zusammen
mit der nachfolgenden Katastrophe von Fukushima bewirkte es eine geradezu vernichtende
Wahlniederlage der bis dahin ununterbrochen regierenden CDU mit dem Kernkraft-Fan
Mappus als Ministerpräsident an der Spitze, von der sich die Partei bis
heute nicht erholt hat. Zu den kleineren Kollateralschäden gehörte
aber auch, dass die neue grün-rote Landesregierung die Orientierung der
EnBW auf den zwar bereits beschlossenen, aber noch nicht vollständig umgesetzten
"Unabhängigen Transportnetzbetreiber" gefährdete. Dem neuen
Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) kam nämlich die Idee,
das Transportnetz der EnBW zu verkaufen, um den Erlös in erneuerbare Energien
zu investieren. Da nun anstelle der EDF die Landesregierung bei der EnBW
das Sagen hatte, war das mehr als ein unverbindlicher Vorschlag (110705).
"Das Management der gesamten Wertschöpfungskette ist
ein erfolgreiches Geschäftsmodell, das werden wir nicht grundlos
aufgeben",
erklärte daraufhin ein EnBW-Sprecher. Der Konzernchef Villis äußerte
seine Ablehnung nicht ganz so kategorisch, machte aber zur Bedingung,
daß
die EnBW die Mehrheit am Transportnetz behalten müsse (was sich in der
Praxis freilich nur mit dem Modell des "Unabhängigen
Transportnetzbetreibers" erreichen ließ). Vermutlich war diese
Unbotmäßigkeit
einer der Gründe, weshalb dann sein Vertrag unter der neuen
Landesregierung
nicht verlängert wurde, obwohl Villis dazu durchaus bereit gewesen
wäre
(120315).
Bevor Villis den Vorstandsvorsitz der EnBW am 1. Oktober 2012
seinem Nachfolger Frank Mastiaux übergab, stellte er aber schon mal die
Weichen in die richtige Richtung: "Die EnBW hat sich für das Modell
des sogenannten 'Unabhängigen Transportnetzbetreibers' entschieden, das
den Verbleib der TransnetBW im EnBW-Konzern ermöglicht", hieß
es in der Pressemitteilung vom 2. März 2012, mit der die Umbenennung der
bisherigen EnBW Transportnetze AG ab diesem Tag bekanntgegeben wurde. Am 15.
April 2013 kam dann die Mitteilung, dass die Bundesnetzagentur dem Antrag auf
Zertifizierung als UTB stattgegeben habe.
(Einige Passagen dieses Textes sowie die beiden Grafiken
sind der Nr. 230201entnommen worden)