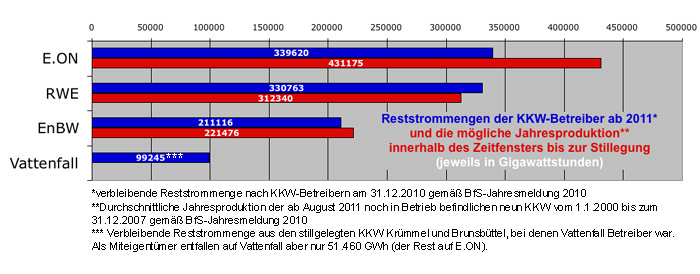|
Die KKW-Betreiber behaupten vor dem Bundesverfassungsgericht,
daß die seit 2011 geltenden Schlußtermine für den KKW-Betrieb
es nicht zulassen würden, die noch vorhandenen Reststrommengen
abzuarbeiten. Dieses Argument sticht aber nicht, wie diese Grafik zeigt:
Bei E.ON und EnBW sind die Reststrommengen (blau) offensichtlich geringer
als die Strommengen, die bei einer durchschnittlichen Jahresproduktion
bis zur endgültigen Stillegung erzeugt werden könnten (rot).
E.ON bekam überdies genug Spielraum eingeräumt, um fast alle
Reststrommengen seines Geschäftspartners Vattenfall zu übernehmen,
der mit der Stillegung der Kernkraftwerke Krümmel und Brunsbüttel
aus dem Kreis der Atomstromerzeuger ausgeschieden ist. Die EnBW kommt
ebenfalls gut zurecht. Lediglich RWE muß sich etwas anstrengen,
um seine Reststrommenge bis zur letzten Gigawattstunde ausschöpfen
zu können. Diese Reststrommenge besteht allerdings zu 30 Prozent
aus einem rein fiktiven Kontingent für das 1988 stillgelegte KKW
Mülheim-Kärlich (030906), das RWE
vor 16 Jahren bei den Verhandlungen über den Atomkompromiß
zugestanden bekam (000601).
Diese Grafik wurde bereits für die ENERGIE-CHRONIK vom Juni
2011 erstellt. Sie basiert auf den Reststrommengen, die das Bundesamt
für Strahlenschutz zum 31.12.2010 ermittelte. Für die neun
Kernkraftwerke, die nach § 7 Abs. 1a AtG vorläufig weiter
in Betrieb blieben, wurde die durchschnittliche Jahresproduktion zugrunde
gelegt, die sie im Zeitraum von 2000 bis 2007 erreichten. |
Verfassungsgericht verhandelt Klagen gegen Änderung des Atomgesetzes
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts verhandelte am 15. und 16. März
erstmals über die Verfassungsbeschwerden, mit denen die KKW-Betreiber E.ON,
RWE und Vattenfall die Änderung des Atomgesetzes anzufechten versuchen,
die der Bundestag am 30. Juni 2011 beschlossen hat (110601).
Mit ihrer Klage verfolgen die drei Konzerne erklärtermaßen keine
Rückgängigmachung oder Änderung der seitdem geltenden Gesetzeslage.
Es geht ihnen vielmehr darum, bei einem für sie positiven Urteil Schadenersatzansprüche
in Milliardenhöhe anmelden zu können. Aber auch das dürfte letztendlich
nicht das eigentliche Ziel sein: Einen Verzicht auf diese Schadenersatzklagen
könnten sie sich dann mit politischen Gegenleistungen honorieren lassen
– etwa bei den gegenwärtigen Verhandlungen über die Haftung
für die radioaktiven Hinterlassenschaften der Atomstromerzeugung.
Die vom Bundestag beschlossene Regelung bietet kaum juristische Angriffsflächen
Im Unterschied zum vorangegangenen "Moratorium", das die schwarz-gelbe
Bundesregierung nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima durchsetzte, bietet
die später vom Bundestag beschlossene Neufassung des Atomgesetzes kaum
juristische Angriffsflächen (110601).
Für die sofortige, auf drei Monate befristete Abschaltung der ältesten
Kernkraftwerke gab es von Anfang an weder einen vernünftigen Grund noch
eine ausreichende gesetzliche Grundlage (110302). Sie
hielt deshalb einer gerichtlichen Überprüfung auch nicht stand (siehe
Hintergrund). Die später vom Bundestag beschlossene
Re-Revision des Atomgesetzes hat dagegen im wesentlichen nur den alten Rechtszustand
wiederhergestellt, wie er bis Ende 2010 galt, bevor die schwarz-gelbe Koalition
den KKW-Betreibern eine enorme Aufstockung ihrer Reststrommengen und damit Laufzeiten-Verlängerungen
bis zu 14 Jahre bescherte (100901).
Eine Verletzung des Grundrechts auf Eigentum ist nicht erkennbar
Bei der mündlichen Verhandlung in Karlsruhe zeigte sich, daß die
Richter die paar Monate zwischen der Verlängerung der KKW-Laufzeiten und
der Re-Revision des Atomgesetzes kaum als Grundlage für eventuelle Ansprüche
der KKW-Betreiber ansehen oder zumindest an sehr enge Voraussetzungen binden
werden. Außerdem wurde deutlich, daß sie eine Verletzung des Grundrechts
auf Eigentum – ein Argument, auf daß sich die Anwälte der Konzerne
von Anfang an konzentrieren wollten (110601)
– schwerlich zu erkennen vermögen. Schließlich behielten die
KKW-Betreiber nicht nur ihre Reaktoren, sondern auch alle Reststrommengen, wie
sie im ersten Ausstiegsgesetz mit ihrem Einverständnis festgeschrieben
wurden. Die Grundentscheidung für oder gegen die Kernenergie obliegt aber
allein dem Gesetzgeber. Dies hat das Bundesverfassungsgericht bereits 1978 festgestellt,
als die nordrhein-westfälische Atomaufsicht dem "Schnellen Brüter"
in Kalkar die Betriebsgenehmigung verweigerte. Bundesumweltministerin Barbara
Hendricks (SPD) zitierte bei der Anhörung in Karlsruhe genüßlich
aus diesem Beschluß.
Trotz der Schlußtermine könnten die Reststrommengen abgearbeitet
werden
Im wesentlichen werden die KKW-Betreiber deshalb wohl das Argument strapazieren,
daß sie die zugestandenen Reststrommengen nicht rechtzeitig abarbeiten
könnten. Mit der Re-Revision des Atomgesetzes wurden nämlich zusätzlich
Schlußtermine eingeführt, bis zu denen die noch in Betrieb befindlichen
KKW in jedem Fall vom Netz gehen müssen. Das damit festgelegte Zeitfenster
sei zu knapp bemessen worden, behaupten die Konzerne. Indessen stimmt das so
nicht, wenn man die durchschnittliche Jahresproduktion zugrundelegt, die von
den jeweiligen Reaktoren im Zeitraum von 2000 bis 2007 erreicht wurde. Lediglich
der RWE-Konzern müßte sich etwas anstrengen, um auch die Reststrommenge
für Mülheim-Kärlich restlos abarbeiten zu können (siehe
Grafik). Das KKW Mülheim-Kärlich war kurz nach
seiner Inbetriebnahme schon 1988 stillgelegt worden – also zwölf
Jahre vor dem politischen Kuhhandel zwischen KKW-Betreibern und rot-grüner
Bundesregierung, bei dem RWE eine fiktive Reststrommenge für den längst
nicht mehr am Netz befindlichen Reaktor zugestanden wurde (000601).
Von diesen 107.250 Gigawattstunden waren 2011 noch 99.150 GWh übrig, da
RWE im Juni 2010 die Übertragung von 8.100 GWh auf den Reaktor Biblis B
vorgenommen hat (130607).
Bei Vattenfall und EnBW hapert es mit der Befugnis zu einer Verfassungsbeschwerde
Bei der Verhandlung in Karlsruhe wurde E.ON durch den Vorstandsvorsitzenden
Johannes Teyssen persönlich vertreten. RWE begnügte sich mit Matthias
Hartung, dem Chef der RWE Power AG, die auch für die Kernkraftwerke zuständig
ist. Sozusagen am Katzentisch war außerdem Vattenfall vertreten. Der schwedische
Staatskonzern ist als ausländisches Unternehmen wahrscheinlich nicht zu
einer Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe berechtigt. Er hat ersatzweise von
der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Bundesrepublik wegen Verletzung der
"Europäischen Energie-Charta" beim ICSID-Schiedsgericht der Weltbank
in Washington zu verklagen (141001). Die Energie Baden-Württemberg
(EnBW) hat auf eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe schon 2012 verzichtet,
weil sie als hundertprozentiges Unternehmen der öffentlichen Hand zu einem
solchen Schritt nicht befugt wäre (120714).
Links (intern)
- Vattenfall verlangt 4,7 Milliarden Euro Entschädigung für Atomausstieg
(141001)
- EnBW klagt als einziger der vier Konzerne nicht gegen den Atomausstieg (120714)
- E.ON klagt in Karlsruhe gegen den Atomausstieg und will Schadenersatz (111103)
- Vattenfall will Deutschland wegen Verletzung der Energie-Charta verklagen
(111103)
- Atomgesetz kehrt zur alten Regelung zurück und setzt zusätzlich
Schlußtermine (110601)
- Bundesregierung läßt sieben Kernkraftwerke vorübergehend
abschalten (110302)
- Link-Liste zum Atomausstieg (Energiekonsens,
Restlaufzeiten, Energiewende-Diskussion usw.)
- Hintergrund: Rechtswidrig, riskant und teuer:
Der Theaterdonner mit dem Moratorium (Februar 2015)