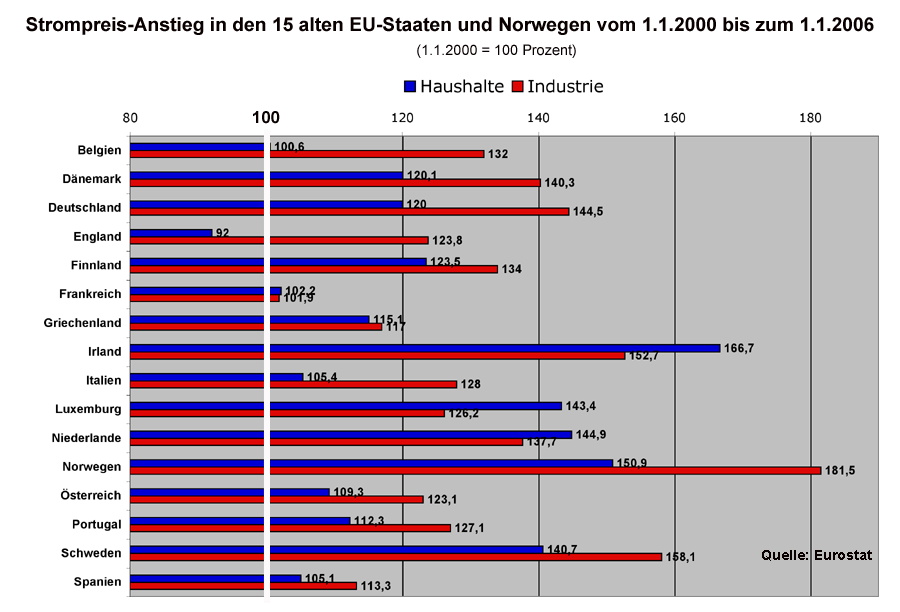
(Aus: Udo Leuschner, „Kurzschluß
- wie unsere Stromversorgung teurer und schlechter wurde“, S. 211 - 219) |
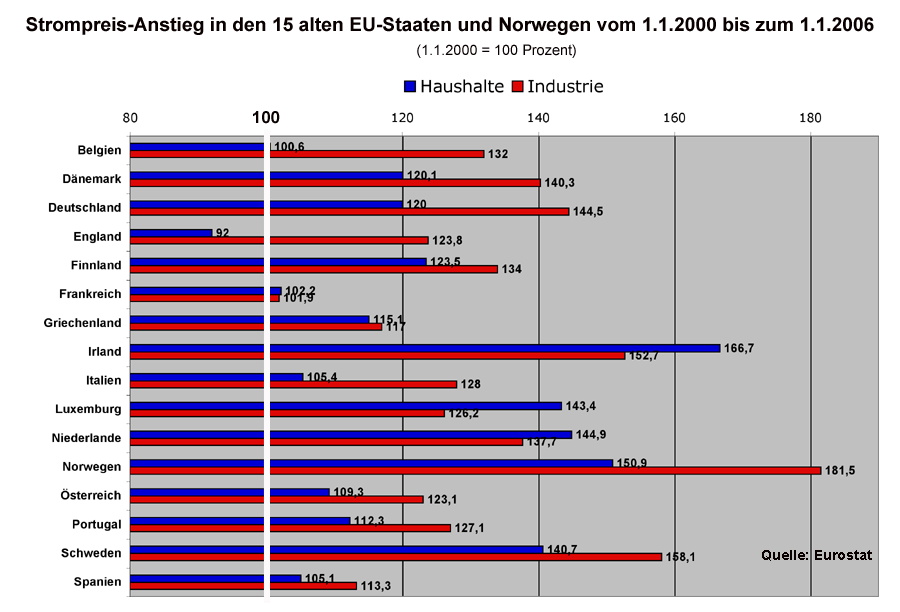
Mit Ausnahme Englands – und hier auch nur bei den Haushalten – waren die Strompreise in allen Mitgliedsländern der Union seit der Liberalisierung gestiegen, zum Teil sogar bis über die Hälfte. Die Geister, die Brüssel mit den Deregulierungsvorschriften entfesselt hatte, verhielten sich offenbar nicht so, wie erwartet worden war. Vielmehr schienen die Skeptiker recht zu behalten, die schon immer davor gewarnt hatten, die Versorgung mit Strom und Gas nach Art eines normalen Warenhandes liberalisieren zu wollen. Deregulieren ließen sich ohnehin nur Erzeugung und Vertrieb. Die Netze waren und blieben ein natürliches Monopol, das nur mit enormem Aufwand neutralisiert werden konnte.
Die Liberalisierung der Stromwirtschaft war vor allem unter dem Druck und nach den Vorgaben der EU-Kommission in Brüssel erfolgt. Mit ihren Richtlinien für den Strom- und Gasbinnenmarkt gab sie den nationalen Gesetzgebern deren Handeln vor, wobei anfängliche Zugeständnisse wie das Alleinabnehmermodell (Frankreich) und der verhandelte Netzzugang (Deutschland) mit der Neufassung der Richtlinien im Jahre 2003 wieder zurückgenommen wurden. Ferner beeinflußte die Kommission die nationale Strom-Gesetzgebung über ihre Richtlinien zur Förderung der erneuerbaren Energiequellen (2001), zur Besteuerung von Energieerzeugnissen (2003), zum Handel mit Emissionszertifikaten (2003/2004), zur Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung (2004) und zur Gewährleistung von Infrastrukturinvestitionen (2006). Mit der Verordnung über Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel (2003) setzte sie sogar unmittelbar geltendes Recht.
Obwohl alle diese Rechtsakte mit Zustimmung des Europäischen Parlaments erfolgten, blieb die Europäische Union ein recht autokratisch geprägtes Gebilde, in dem die Europäische Kommission als supranationale Einrichtung, der Ministerrat aus Vertretern der nationalen Regierungen sowie der Europäische Rat mit den Staats- und Regierungschefs als oberstes politisches Entscheidungsgremium das Sagen hatten. Die Kommission fungierte nicht nur als Exekutive, sondern auch als Initator von Rechtsakten. An dieser Exekutivlastigkeit der Europäischen Union änderte auch der Vertrag von Maastricht nicht viel, der seit 1992 dem Europäischen Parlament bestimmte Mitentscheidungsrechte gewährte, zu denen energiepolitische Fragen gehörten.
Es war indessen weniger dieses Demokratie-Defizit, was die Bürger der Mitgliedsstaaten zunehmend mit Mißtrauen und Unzufriedenheit nach Brüssel blicken ließ. Auch mit dem schon immer beklagten Bürokratismus der europäischen Institutionen und ihrer teilweise uneffizienten Verwendung von Steuergeldern – beginnend bei der eigenen, hochbezahlten Bürokratie – hätte man sich wohl noch abgefunden. Was aber vielen zu weit ging, war die expansive, an neoliberalen Maximen ausgerichtete Politik der Europäischen Union. Vor allem in den Kernländern der früheren EWG wuchs das Unbehagen über nachteilige Folgen der Brüsseler Politik, die erklärtermaßen auf den Ausgleich des bisherigen Gefälles zwischen armen und reichen Mitgliedsstaaten zielte, während über die Außengrenzen der Gemeinschaft der kalte Wind der Globalisierung hereinwehte. Verschärft wurde dieses Problem durch die Erweiterung der Union von 15 auf 25 Staaten, die im Mai 2004 dem bisher westeuropäisch geprägten Staatenverbund acht frühere osteuropäische Vasallen der Sowjetunion sowie die Kleinstaaten Zypern und Malta hinzufügte. Als ob die EU sich damit noch nicht genug soziale und demokratische Probleme aufgehalst hätte, verhandelte sie bereits mit Bulgarien, Rumänien und der Türkei über deren Beitritt. In den Augen vieler Bürger glich die EU damit einem Unternehmen, das seine Expansion mit faulen Krediten betrieb, zum Schaden der Alteigentümer windige neue Teilhaber aufnahm und der Stammbelegschaft die Sozialleistungen kürzte.
Der aufgestaute Unmut entlud sich bei den Volksabstimmungen über die geplante Europäische Verfassung, die ursprünglich 2006 in Kraft treten sollte. In Deutschland und den meisten anderen Ländern der Union genügte für die Ratifizierung des Verfassungsvertrags die Zustimmung des Parlaments. In Frankreich und den Niederlanden mußten dagegen Volksabstimmungen durchgeführt werden, wobei am 29. Mai bzw. 1. Juni 2005 die Mehrheit der teilnehmenden Bürger das Vertragswerk ablehnte. Das Scheitern in zwei Gründungsstaaten der EWG stoppte bis auf weiteres die geplante neue Form der politischen Integration.
Die Europäische Union stand seitdem unter Druck. Sie mußte zusätzlich in Mißkredit geraten, wenn sich die Liberalisierung der Energiemärkte als grandioser Fehlschlag herausstellen sollte. Tatsächlich war bisher von den versprochenen Segnungen des Wettbewerbs nichts zu spüren. Anstatt zu sinken, gingen die Strompreise nach oben. Deutschland war keineswegs ein Einzelfall, wie die obige Übersicht zeigt.
Außerdem waren die bestehenden Netze nur für den Transport und die Verteilung des Stroms bis zu den Endkunden gedacht. Sie waren nicht für den nun einsetzenden Stromhandel ausgelegt, der die vorhandene Infrastruktur mit zusätzlichen Stromflüssen belastete, die unter dem Gesichtspunkt der reinen Versorgung gar nicht notwendig waren. Die stündliche Veränderung der „Fahrpläne“ destabilisierte die Versorgungssicherheit zusätzlich. Vor diesem Hintergrund kam es am 4. November 2006 zu dem europaweiten Stromausfall, den der deutsche Netzbetreiber E.ON durch eine Fehlschaltung auslöste, die ein nicht überlastetes Netz toleriert hätte.
Vor allem an den grenzüberschreitenden Leitungen kam es zu chronischen Engpässen. Die Netzbetreiber versteigerten deshalb die knappen Kapazitäten an den Meistbietenden. Die ursprüngliche Idee, durch billige Stromimporte aus dem Ausland für Wettbewerb zu sorgen, wurde so ad absurdum geführt.
An den europäischen Strombörsen kannten die Preise sowieso nur eine Richtung, und die wies nach oben. Zusätzlichen Auftrieb erhielten die Großhandelspreise durch die Einführung des Handels mit Emissionszertifikaten, weil die Energiekonzerne den Börsenwert ihrer kostenlos erhaltenen Zertifikate kurzerhand auf die Strompreise aufschlugen. Der Handel mit Emissionszertifikaten ging ebenfalls auf eine EU-Richtlinie zurück.
Grund genug also für die EU-Kommission, den Stand der Dinge mit großer Sorge zu betrachten und auf Abhilfe zu sinnen. Ein Zurück kam nicht in Frage. Denn die Geister, die sie mit der Deregulierung der Energiemärkte beschworen hatte, bekam sie nicht mehr in die Flasche zurück. Unter den gegebenen Umständen konnte sie nur die Flucht nach vorn antreten.
Als erstes setzte die EU-Kommission mit dem Segen des Parlaments und des Rats die beiden neuen Richtlinien zur Beschleunigung der Binnenmärkte für Strom und Gas durch, die im Sommer 2003 in Kraft traten. Sie sollten bis zum 1. Juli 2004, also binnen eines Jahres, in nationales Recht umgesetzt werden. Tatsächlich hatten aber im Herbst 2004 nicht weniger als 18 der 25 EU-Staaten – darunter auch Deutschland – die Richtlinie noch immer nicht umgesetzt, weshalb sie von der Kommission abgemahnt wurden. Fünf der Staaten verhielten sich sogar so halsstarrig, daß die Kommission sie ein Jahr später beim Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften verklagen mußte. Deutschland kam nur knapp an einer solchen Klage vorbei, nachdem es das neue Energiewirtschaftsgesetz zur Umsetzung der EU-Richtlinie mit einjähriger Verzögerung am 13. Juli 2005 in Kraft gesetzt hatte.
Gleichzeitig mit den beiden neuen Richtlinien erließ die Kommission eine Verordnung über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel, die zum 1. Juli 2004 in Kraft trat. Sie billigte den Übertragungsnetzbetreibern einen Ausgleich für die Kosten zu, die ihnen durch grenzüberschreitende Stromflüsse entstehen. Diese Kosten durften aber nicht den Exporteuren oder Importeuren von Strom auferlegt, sondern mußten von der Gesamtheit der jeweiligen nationalen Netzbetreiber getragen werden.
Kurz nach Erlaß der Beschleunigungsrichtlinien und der Netzzugangsverordnung legte die Kommission im Dezember 2003 ein Gesetzgebungspaket vor, mit dem sie die Energieinfrastruktur und Versorgungssicherheit in den Mitgliedsstaaten stärken wollte. Bei der Stromwirtschaft stieß das Gesetzespaket auf entschiedene Ablehnung, da es die unternehmerische Handlungsfreiheit der Netzbetreiber und Energieversorger beschneiden würde. Die rot-grüne Bundesregierung sah in den Plänen ebenfalls einen „dirigistischen Eingriff“. Beispielsweise sollten die Regulierungsbehörden ermächtigt werden, die Fertigstellung von Projekten zu beschleunigen oder gar selber eine Ausschreibung vorzunehmen, falls der Übertragungsnetzbetreiber nicht fähig oder nicht willens ist, bestimmte Projekte zu vollenden.
Ende 2004 entschärften die Energieminister der EU die Vorlage. Der Kommission war es nun nicht mehr möglich, die Netzbetreiber bei Investitionsentscheidungen auf den Vorrang des Nachfragemanagements oder der Einspeisungsmöglichkeiten für Strom aus erneuerbaren Energien verpflichten. Abgeschwächt wurde auch die Einflußnahme von Kommission und Regulierungsbehörden auf den Bau von grenzüberschreitenden Verbindungsleitungen zur Beseitigung von Engpässen innerhalb des Verbundnetzes.
In ihrem jährlichen Bericht über die Verwirklichung des Strom- und Erdgasbinnenmarktes, den sie Anfang 2005 vorlegte, bekannte die Kommission das Scheitern aller bisherigen Versuche, die nationalstaatliche Energieversorgung in einen größeren europäischen Markt zu integrieren. In zu vielen Mitgliedsstaaten werde die Marktstruktur von ein oder zwei Unternehmen beherrscht. Die Entflechtung der Netzbetreiber und die Regeln für den Netzzugang Dritter seien besonders im Verteilungsbereich noch nicht zufriedenstellend gelöst. Deshalb müßten die Regeln für den grenzüberschreitenden Stromhandel weiter verbessert und auch im Gassektor die Infrastrukturinvestitionen vorangetrieben werden. „Keine größeren Probleme“ beim Wettbewerb bescheinigte die Kommission lediglich Schweden, Finnland, Dänemark, Norwegen und Großbritannien, wo mehr als fünfzig Prozent der Großkunden seit der Marktöffnung den Lieferanten gewechselt hatten. In Deutschland hätten dagegen bisher nur 35 Prozent der Großkunden gewechselt. In den anderen Mitgliedsstaaten liege die Wechselrate zwischen null Prozent (Griechenland, Estland) und 35 Prozent (Niederlande).
Im Juni 2005 startete die Kommission eine Untersuchung des Energiesektors. Deren vorläufiges Ergebnis bestätigte vor allem fünf Fehlentwicklungen:
– Fortdauer des hohen Konzentrationsgrades aus der Zeit vor der Liberalisierung auf der Großhandelsebene, so dass die etablierten Betreiber die Preise anheben können.
– Mangelnde Wahlfreiheit für die Verbraucher, weil Neuanbieter nur schwer auf dem Markt Fuß fassen können. Infrastruktur- und Versorgungsaufgaben sind nur unzureichend voneinander getrennt, weswegen die Neuanbieter die Endverbraucher nicht erreichen.
– Grenzüberschreitender Wettbewerb findet so gut wie nicht statt. Neue Gasanbieter können auf wichtigen Strecken keinen Zugang zu grenzüberschreitenden Rohrleitungen erlangen; und im Elektrizitätswesen reichen die Kapazitäten der Verbindungsleitungen oftmals nicht aus oder sind durch langfristige Reservierungen blockiert.
– Neuanbieter haben keinen Zugang zu den Informationen, die für einen wirksamen Wettbewerb unerlässlich sind. Dieser Mangel an Transparenz begünstigt alteingesessene Unternehmen und hält Neuanbieter vom Markt fern.
– Preise werden selten auf der Grundlage von effektivem Wettbewerb gebildet und viele Stromkunden misstrauen dem Preisbildungsmechanismus. Dieser Mechanismus müsse sorgfältig beobachtet werden.
Die Kommission nahm die Ergebnisse der Untersuchung zum Anlaß, um ihrer wiederholten Kritik am mangelnden Wettbewerb bei Strom und Gas endlich Taten folgen zu lassen. Am 16. Februar 2006 kündigte Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes die Einleitung mehrerer Verfahren an, um die Abschottung der Gas- und Strommärkte durch langfristige Bezugsverträge auf nachgelagerten Märkten sowie Einschränkungen des freien Zugangs zu Leitungs- und Speicherinfrastruktur zu beseitigen. Sie stützte sich dabei auf die Artikel 81 und 82 des EG-Vertrags, die wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen und eine mißbräuchliche Ausnutzung von Marktmacht untersagen. Als erstes verschickte die Kommission im April 2006 Abmahnungen an insgesamt 17 Mitgliedsstaaten, weil sie die Richtlinien zur Beschleunigung der Binnenmärkte für Strom und Gas nur formal, aber nicht in allen Punkten ordnungsgemäß umgesetzt hatten.
Im Mai 2006 ließ die EU-Kommission die Geschäftsräume von Gaskonzernen in Deutschland, Italien, Frankreich, Belgien und Österreich durchsuchen, um Hinweise auf Marktabsprachen und Diskriminierung von Wettbewerbern zu finden. In Deutschland inspizierten sie insgesamt sechs Unternehmen, darunter E.ON Ruhrgas und RWE Energy. Zu den Betroffenen gehörten ferner die französische Gaz de France, die belgischen Unternehmen Distrigas und Fluxys sowie die österreichische OMV. Außerdem wurden in Ungarn mehrere Stromunternehmen durchsucht. Die Prüfer aus Brüssel tauchten an insgesamt zwanzig Standorten auf, wobei sie jeweils von Vertretern der nationalen Kartellbehörden begleitet wurden.
Anscheinend hatten sich verschiedene Konkurrenten bei der Kommission über Absprachen der marktbeherrschenden Konzerne beschwert. So soll E.ON Ruhrgas mit französischen Versorgern die künstliche Verknappung von Gas-Durchleitungskapazitäten vereinbart haben, um potentielle Wettbewerber wie die niederländische Nuon vom deutschen Markt fernzuhalten. Ferner sollen die Großstromerzeuger die Preise für Strom an den Spotmärkten durch Steuerung ihrer Kraftwerkskapazitäten manipuliert haben.
Im Dezember 2006 führte die Kommission weitere „unangekündigte Inspektionen“ bei den vier deutschen Stromkonzernen E.ON, RWE, EnBW und Vattenfall durch. Sie begründete die Razzia mit dem Vorliegen von Hinweisen, daß die Unternehmen die Wettbewerbsregeln des EG-Vertrages verletzt haben könnten, die wettbewerbsbeschränkende Geschäftspraktiken sowie die mißbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung verbieten. Im Klartext: Es ging wieder um den Verdacht von Marktabsprachen und Preismanipulationen an der Strombörse.
Die Kommission suchte vor allem nach belastendem Material für den Nachweis, daß eine bloß juristische Trennung des Netzes von Erzeugung und Vertrieb nicht ausreicht, um die Bevorzugung des konzerneigenen Stromvertriebs und die Diskriminierung von Wettbewerbern zu verhindern. Sie bereitete damit einen politischen Coup vor, der bis dahin eigentlich als Tabu gegolten hatte, nämlich die Forderung nach eigentumsmäßiger Entflechtung der Netze. Damit – so hoffte sie – würde endlich der gordische Knoten der konzerninternen Begünstigungen durchhauen, der bisher sowohl der buchhaltungsmäßigen als auch der juristischen Enflechtung widerstanden hatte.
Die neue Marschroute verkündete EU-Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes erstmals im September 2006 bei einem Seminar der britischen Regulierungsbehörde Ofgem in London: Die eigentumsmäßige Trennung des Netzbereichs von Erzeugung und Vertrieb sei erforderlich, um Interessenkonflikte wirksam zu beseitigen und die notwendigen Investitionsanreize zu schaffen. Eine lediglich juristische Entflechtung des Netzes von anderen Konzernbereichen biete keine Gewähr für die Gleichbehandlung der Netznutzer. Vor kurzem hätten zwei nationale Wettbewerbsbehörden hohe Geldstrafen verhängen müssen, weil Netzbetreiber die Erzeugungs- bzw. Vertriebsgesellschaft des eigenen Konzerns bevorzugt hätten. Dies veranschauliche die Schwierigkeit, den Netzbetrieb in einem integrierten Stromkonzern zu belassen und zugleich durch eine interne „chinesische Mauer“ von den anderen Geschäftsbereichen zu trennen.
Zunächst war nicht ganz klar, wieweit die Kommission als Ganzes hinter der Wettbewerbskommissarin stand. Der gedämpfte Trommelwirbel entwickelte sich aber schnell zum Paukenschlag, als die EU-Kommission am 10. Januar 2007 ein integriertes Klima- und Energiepaket vorlegte, das ausdrücklich eine eigentumsmäßige Trennung der Netze von Erzeugung und Vertrieb verlangte. Ersatzweise – aber nur als schlechtere Lösung – schlug die Kommission die Zusammenfassung aller nationalen Netze unter dem Dach einer gemeinschaftlichen Netzorganisation vor, die ihrerseits den Netzeigentümern gehören würde und als „Independant System Operator“ (ISO) für die Betriebsführung zuständig wäre.
Die zweite Lösung war offenbar als politischer Kompromiß gedacht, um den Widerstand der betroffenen Energiekonzerne bzw. einzelner Staaten wie Frankreich und Deutschland überwinden zu können. Die Kommission gab diesen Regierungen indessen zu bedenken, daß bei dem ISO-Modell ein erheblicher regulativer Aufwand nötig sein werde, um die Unabhängigkeit der Betriebsführung gegenüber den Interessen der Netzeigentümer zu wahren.